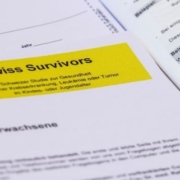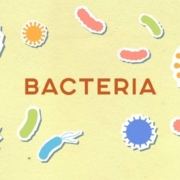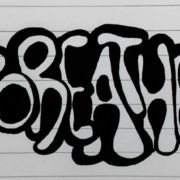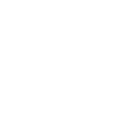Mehr Unterstützung bei chronischen Schmerzen
Kinder und Jugendliche mit onkologischen und hämatologischen Erkrankungen sind immer wieder Schmerzen ausgesetzt – wegen der Krankheit, aber auch infolge von Interventionen. Weil diese kurzfristigen Schmerzen immer wieder auftreten, können sie chronischen werden. Schon die Furcht davor kann die Lebensqualität beeinträchtigen.
Mit dem Projekt soll die Versorgungslücke der Betreuung und Begleitung der onkologischen und hämatologischen Kinder und Jugendlichen mit chronischen Schmerzen geschlossen werden.
Den chronischen Schmerzen in der pädiatrischen Onkologie soll im UKBB mehr Beachtung geschenkt werden. Dafür wurde die Pflegeexpertin Diana Vogt als Advanced Practice Nurse (APN) im UKBB implementiert. In einem Gespräch erfasst die APN die Schmerzsituation. Dabei erfragt sie durch gezielte Fragestellungen die Situation sowie die Auswirkungen und die Belastung der Schmerzen auf den Alltag. Wenn sich laut Definition chronische Schmerzen zeigen, bietet die APN Schmerzedukationen und Schmerzberatungen an.
Phase 1
In Phase 1 des Projekts wurden 2024 rund 10 Patienten:innen von der APN betreut. Diese befanden sich in verschiedenen Stadien ihrer Therapie. Alle zeigten eine Belastung durch das Symptom Schmerzen. Als Therapie wurden mit diesen betroffenen Kindern und Jugendlichen durch die APN zwischen 1-3 Schmerzedukationen und -beratungen durchgeführt. Die Schmerzedukationen hatten einen zeitlichen Rahmen von 60-90 Minuten. Diese Dauer wurde individuell an die Konzentration und die Bedürfnisse der Patient:innen angepasst.
Die gemeinsam entwickelten Strategien sind nach Aussagen der Betroffenen gut umsetzbar, und sie erleben einen deutlich positiven Einfluss auf die Schmerzstärke. Auch die Rückmeldungen der Eltern sind durchweg erfreulich. Diese berichten unter anderem, dass sie ihre Kinder wieder fröhlicher und aktiver erleben.
Phase 2
Phase 2 ist nun im Jahr 2025 gestartet und auch dieses Jahr unterstützen wir das Projekt finanziell, damit sich die Lebensqualität der Kinder und ihrer Familien verbessert.
Pflegedienstleitung Caroline Stade, Diana Vogt, Prof. Dr. med. Nicolas von der Weid und Dr. med. Andreas Wörner (v. li.)
Unser Projektpartner ist Universitäts-Kinderspital beider Basel (UKBB), Diana Vogt, Pflegeexpertin MScN in der hämato-/onkologischen Abteilung (Station C)